Olfaktorisch evozierte Potenziale (objektive Riechprüfung)
Ableitung von olfaktorisch evozierten Potenzialen (OEPs)
Zur Ableitung von OEPs [1] bläst ein Olfaktometer kontinuierlich angewärmte, angefeuchtete Luft in die Nase. Alle 30–40 s wird ein olfaktorischer oder trigeminaler Reiz von 200 ms Dauer hinzugefügt, und es wird das entsprechende Potenzial aus dem EEG gefiltert. Der Patient wird wegen der Lautstärke des arbeitenden Olfaktometers mit weißem Rauschen vertäubt, die Augen sind geöffnet, und zur Konstanthaltung der Vigilanz macht er ein Videospiel. Die Testung des trigeminalen Reizstoffes erfolgt zum Schluss, da CO2 eine Schleimhautschwellung auslöst. Die olfaktorischen Reizstoffe sind Vanillin (nur 2 Stunden haltbar), Phenylethylalkohol „Rose“ und H2S. Es werden 15–20 Reize pro Stoff und Seite gegeben, die Untersuchungsdauer beträgt ca. 1 Stunde. Eine Veränderung des Potenzials läßt sich nach ca. 200–800 ms messen, trigeminale Potenzialänderungen sind früher messbar als olfaktorische. Die Höhe der Potenzialänderung entspricht nicht dem Geruchsvermögen.
Vorteile: Dies ist ein objektives Meßverfahren.
Nachteile: Die Messung ist mit einem hohen apparativen Aufwand verbunden. Die Synchronisation der Reize ist abhängig von der Atemtechnik und von der Mitarbeit des Patienten.
Ableitung von OEPs mit kognitiven Potenzialen / CNV (contingent negative variation)
Direktes Verfahren
Auf einen Duftreiz folgt 1,5 s später ein Ton (500 Hz, 70 dB). Durch den Duftreiz lässt sich ein OEP messen, danach kommt es durch die Erwartungshaltung zu einer Abnahme des Potenzials (CNV) und durch den Ton und Knopfdruck des Patienten zum sofortigen Abbruch des CNV sowie zu einem AEP (auditiv evozierten Potenzial) . Das CNV zeigt sich 0,8–1,7 s nach der Duftgabe [2].
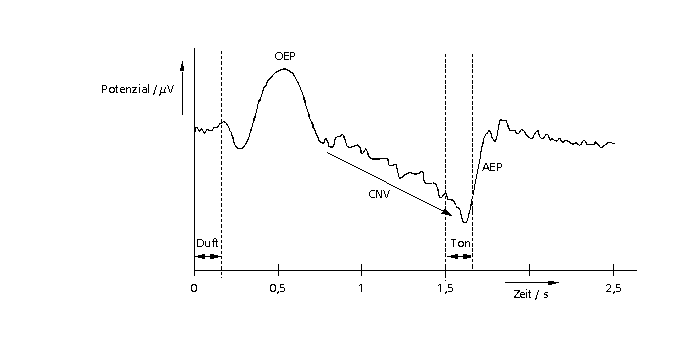
Abbildung: Verlauf von OEP mit kognitivem Potenzial [2]
Selektives Verfahren
Von zwei Duftreizen wird nur einer stets mit einem Ton gekoppelt. Der Normosmiker zeigt nur beim Duftreiz mit Ton ein CNV. Auf diese Weise kann beim Normosmiker eine Unterscheidung von Duftreizen messbar registriert werden [2].
Vorteil: Die Messung ist nicht von der Atemtechnik des Patienten und der genauen Reizgabe des Olfaktometers abhängig. Die OEPs mit CNV sind sensitiver als die OEPs alleine.
Nachteil: Die Konzentration des Patienten ist erforderlich.
[1] Welge-Lüßen A, Wolfensberger M, Kobal G, Hummel T. Grundlagen, Methoden und Indikationen der objektiven Olfaktometrie. Laryngorhinootologie. 2002 Sep;81(9):661-7.
[2] Mrowinski D, Eichholz S, Scholz G. Objektiver Riechtest mit kognitiven Potenzialen. Laryngorhinootologie. 2002 Sep;81(9):624-8.